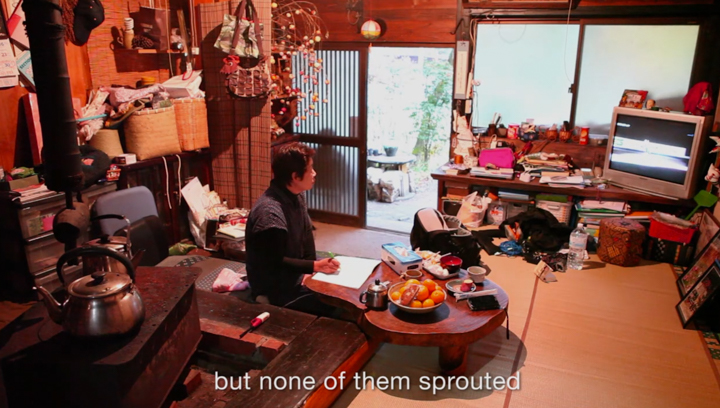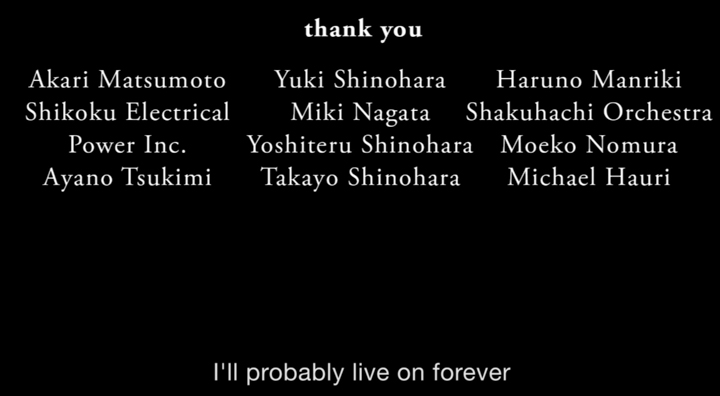Die Geschichte ist zwar nur 6:30 Minuten lang, aber trotzdem habe ich länger als einen Monat am Schnitt gefeilt. Hier nun ein paar Details, die beim Betrachten vielleicht nicht auffallen, die aber trotzdem enthalten sind.
Der Director’s Commentary sozusagen.

So sieht es aus, wenn man alle Clips und Töne über-, neben- und durcheinander schiebt. Sollte eigentlich sauberer sein, aber dem fertigen Film sieht man das Chaos ja nicht an…
Es ist immer so ein kleiner, magischer Prozess, finde ich, wenn aus Gedanken, Clips, Fotos und Tönen dann ein fertiger kleiner Film wird. Denn lange Zeit ist es erstmal nichts, nur ein paar Dateien.
Man kommt mit vielen Daten von der Reise zurück und muss alles soweit kondensieren, dass ein anderer die Geschichte versteht, ohne dass ich daneben stehe und alles erkläre. Auf dem Weg dahin kann viel schief gehen.
Ein Foto machen, das ist einfach. Kamera an und los. Beim Film kommt noch so viel mehr dazu. Mikros brauchen frische Batterien, das Aufnahmegerät noch zusätzlich Kabel und eine frische Speicherkarte. All den Kram schleppt man dann nach hause und hofft, dass auch ja alles drauf ist, denn man kann es nicht reproduzieren. Dann schnell zwei Backups machen, und am besten noch ein drittes, denn man weiss ja nie.
Langer Prozess
Weil ich so enttäuscht vom Dreh und dem Interview war, habe ich die Puppen lange Zeit unberührt gelassen. Erst Anfang Januar in Tokyo begann ich mit der Bearbeitung der Fotos und der Übersetzung des Interviews. Nach der Ausstellung im Februar stürzte ich mich dann vollends in den Schnitt. Jeden Tag 6-10 Stunden saß ich dann am Rechner, bewegte Clips und schrieb Untertitel. Montag bis Freitag saß ich in der Bibliothek der Uni, am Wochenende dann bei San Marco – einer Starbucks-Kopie mit anständigen Kaffee in der Hondori-Geschäftstraße in Downtown Hiroshima.
Beim Film kann so viel mehr schiefgehen als bei einem Foto, und nun merkte ich auch alle Fehler.
Der Ton war suboptimal. Ich hatte Mikros und Aufnahmegerät kurz vor meinem Abflug gekauft und vorher nicht so wirklich im Einsatz getestet. Manchmal wackelte das Kabel und somit der Ton. Manchmal quatschte ich in meinem Eifer auch der Dame ins Wort, sodass ich einige Passagen nicht nutzen konnte. Aber dem fertigen Film sieht man das alles ja zum Glück nicht an.
Ich hatte mehrere Varianten entwickelt, die ich immer wieder ausgebaut und verworfen habe. Von ursprünglich 8-9 Minuten konnte ich es gut runterkürzen auf 6:30 Minuten. Immer wieder schaute ich mir das Video von Anfang bis Ende an, änderte jedes kleine Element bis es mich nicht mehr störte.
Die erste Version war Mitte/Ende Februar fertig. Ich habe mir dann Feedback eingeholt und die Geschichte etwas ruhen lassen.
Im April setzte ich mich an die letzte Korrektur und die Geschichte war fertig.
Grundlegend habe ich bei dieser Geschichte versucht viel mit subtilen Elementen zu arbeiten. Einfach auch, weil ich keine andere Wahl hatte. Sie spricht viele Sachen nicht direkt aus, also kann ich sie nur andeuten und hoffen, dass der Zuschauer irgendwie versteht, was ich versuche ohne Worte zu transportieren.
Als ich angefangen habe, kurze Filme aus Interviews, Fotos und Videos zu schneiden, dachte ich der Schnitt dient nur dazu, das Material zu zeigen und Zeit zu füllen. Aber man kann so viel mehr damit erzählen.
Bevor wir chronologisch durchgehen, zunächst etwas allgemeines:
Warum?
Das ist die konkrete Fragestellung hinter dem Film, den ich versuche zu beantworten. Das “Wie” habe ich im vorigen Eintrag beantwortet.
Zunächst, warum ich die Geschichte gemacht habe:
Meine Oma ist mir sehr lieb. Sie ist 88 Jahre alt und gesund, aber da viele ihrer Freunde schon gestorben sind, spricht sie häufig vom Tod. Sie sagt beim Besuch immer sowas wie “Na, wer weiß ob wir uns wiedersehen…”
Noch nie ist jemand, der mir nahe stand, gestorben. Ich habe also noch keine direkte Erfahrung mit dem Thema Tod. Deswegen bin ich nach Nagoro gefahren, um vielleicht von der Dame etwas zu lernen, was ich nutzen kann, wenn es soweit ist.
Die stärksten Geschichten kann man erzählen, wenn man persönlich einen Zugang findet. Gleichzeitig hoffte ich auch etwas zu finden, womit andere vielleicht etwas anfangen und davon lernen können.
Der Film handelt nicht von der Dame oder von den Puppen. Es geht um große Themen wie Einsamkeit, Tod, oder Vergessen/Erinnern. Damit kann jeder etwas anfangen. Es sind universelle Themen. Das erklärt mitunter sicher den großen Zuspruch, welcher der Film hatte. Die englische Version steht derzeit bei fast einer halben Million Klicks. Für einen kurzen Dokumentarfilm ist das viel.
Die Frage ist auch: Warum macht sie seit zehn Jahren die Puppen? Ihre Antwort: “Es gab nichts zu tun”. Das stimmt natürlich nur bedingt. Denn der wahre Grund liegt tiefer. Ich habe versucht, durch den Schnitt eine Antwort zu geben, den sie mir im Interview nicht geben wollte.
Gleichzeitig wollte ich eine gewisse Ambivalenz erreichen. Alle Berichte über sie zuvor waren sehr eindeutig. Sie ist verrückt, sie ist einsam, die Puppen sind gruselig, und so weiter. Aber eine Geschichte hat niemals nur eine Seite.
Im fertigen Film wollte ich keine eindeutige Antwort geben, jeder konnte sich selbst seine Antwort suchen.
Gestaltung
Die Musik stammt von einem Senioren-Verein aus Hiroshima, bei der ein Opa einer Kommilitonin spielte. Ich wollte unbedingt Shakuhachi für den Film, das wusste ich schon von Beginn. Der Wald und der Wind im Film werden durch dieses japanische Instrument gut verkörpert. Ich habe also das ganze Konzert aufgezeichnet (vier Stunden) und dann das passende Stück genommen.
Die Geschichte musste unbedingt im Herbst stattfinden, da ich mit der Umgebung die Dame und das Thema charakterisieren wollte. Frühling wäre “Aufbruch” gewesen, Sommer “Leben” und Winter “Stillstand” – alles passte nicht. Herbst war von Anfang an geplant. So setzt allein schon der Hintergrund die richtige Stimmung.
Auch als Journalist kann man viel von Hollywood und seinen Techniken lernen. Den Ansatz mit “Charakterisierung durch Umgebung” stammt von Tim Burtons “Batman” von 1990, wo das düstere Gotham im Stile des Deutschen Expressionismus als Kulisse für die Seele von Bruce Wayne dient.
Aber nun von Anfang an:
Der Beginn muss gleich funktionieren, sonst schalten die Zuschauer online ab oder auf die nächste Website um. Erstes Bild ist ein leeres Puppenauge, das dir direkt in die Seele starrt. Der Wechsel von Schwarz auf Foto ist abrupt, ohne sanften Übergang. Dazu ein Ton der Spannung aufbaut. Die Idee dazu stammt wieder aus Batman, diesmal aus “Dark Knight”. Das erste große Bild im Film ist der Joker von hinten, Fokus auf der Maske. Die ganze Szene beginnt schon früher, mit einem langen Anflug. Aber dazu spielt eben auch ein Ton, der sich erst mit dem Joker auflöst. Man ist sofort drin im Film. Das gleiche habe ich hier versucht.
Hier sieht man zum ersten und einzigen Mal das Tal. Man sieht kaum Häuser und hört das Wasser. Man kriegt gleich ein Gefühl für die Isoliertheit des Ortes, ohne das etwas gesagt werden muss.
Übergang zur Person. Wir haben bisher nur Puppen und nen Fluss gesehen. Wir wissen noch nicht, wer hier überhaupt spricht. Um den Übergang vom Fluss zur Person einfacher zu machen und um gleichzeitig vorzustellen, wie sie lebt (z. Bsp. Feuer statt Elektroheizung) ein Detail.
Das waren die ersten Bilder, die ich filmte. Sie machte das Feuer und den Tee für uns. Das zweite Bild ist vor dem ersten entstanden, das eigentliche Feuer ist nämlich in der großen Öffnung, die beim zweiten Bild zu sehen ist.
Weil ich nur anderthalb Tage fotografierte, hatte ich echt wenig Material. Knapp 85% von dem was ich gedreht habe, ist im Film. Zum Vergleich: Im Projekt, an dem gerade schneide, sind es 15-20%
Es hat ewig gedauert, bis ich das Archiv-Material der Stromfirma bekommen hatte. Auf meine erste Anfrage reagierten sie gar nicht erst. Bei meiner zweiten Mail hieß es dann “Können wir nicht machen”. Eine Freundin, die bei der Stadt Hiroshima arbeitet und mit der ich drüber sprach, fühlte sich herausgefordert. Ein Anruf von ihr später hieß es “wir schicken das Material”.
Stellte sich heraus, dass sie seit Fukushima sehr viel vorsichtiger sind, was ausländische Journalisten und Bildmaterial angeht. Selbst auf Shikoku.
Digital hatten sie allerdings nichts mehr, ich musste alles scannen.
Jetzt sehen wir die Puppen zum ersten Mal in der Szenerie. Auch die Anzahl erstaunt. Die Musik setzt gleich zum ersten Mal aus, denn es ist das Ende vom ersten Akt, der Exposition. Danach wissen wir, wo wir uns befinden und mit wem wir es zu tun haben. Jetzt kann es tiefer gehen.
Denn es taucht zum ersten Mal etwas von der Einsamkeit in Nagoro auf. Das Bild ist auch das einzige von ihr, wo sie durchs Dorf geht. Da hatte sie grad die Schule abgeschlossen und wollte mich abholen, in der Hand ist noch der Schlüssel. Ich wusste, ich brauch das Bild, also musste ich schnell sein und hatte keine Zeit das Bild gerade einzustellen.
Das ist tatsächlich von meinem Hotelzimmer am nächsten Morgen mit dem Teleobjektiv gefilmt. Ich wusste, so ein paar Pflanzen kann man immer gut dazwischen schneiden. Merkt ja keiner wo es ist…
Die Musik löst sich im Windspiel auf. Dazu habe ich einen sehr interessanten Kommentar von einer Japanerin bekommen. Das Windspiel assoziiert man in Japan immer mit dem Sommer. Dass es hier im Herbst noch erklingt ist ein Symbol dafür, dass es schon “jenseits seiner Zeit ist”. Finde ich eine schöne zweite Ebene, welche die Botschaft des Films stützt, und die ich am Anfang gar nicht so gesehen habe.
In das Bild hatte ich mich etwas verliebt und einfach mal zwei Minuten lang drauf gehalten, ich weiss aber nicht, ob auch andere das darin gesehen habe, was ich sah. Das Bild ist eine Metapher für das Leben im Nagoro, daher auch geschnitten zu dieser Aussage. Es dreht sich im Kreis, aber nichts geht voran oder ändert sich. Jahreszeiten wechseln, aber das Leben hier ist doch irgendwo stillgestanden. Die Idee war, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie langweilig es hier oben doch ist.
Hier ein gutes Beispiel, was Untertiteln noch verändern können. Ich musste es verknappen, aber sie zählt hier noch auf, was sie alles angepflanzt hat. Ich konnte es aus dem Interview nicht ausschneiden, aus den Untertiteln aber schon.
Die Tasche und der Kram hinten ist meins, ich hab verpeilt es wegzuräumen. Na, ist hoffentlich keinem aufgefallen…
Hier auch, das ist mein Samsung Galaxy auf dem Tisch…
Das ist die Hand einer Besucherin, man erkennt es vielleicht am dicken Ring. Aber von der Puppenfrau gab es kein Bild, wo sie eine Puppe macht, obwohl es für die Geschichte wichtig ist. Sie ist direkt danach im Bild, also wird angedeutet, dass sie es ist…
Während des Interviews habe ich nicht viel verstanden, aber das schon: “Lippen” und “Augen”. Also war mir am nächsten Tag klar: Heute fotografierst du Gesichter! Ich hatte am Ende mehrere Dutzend, von denen ich dann die besten vier auswählte.

Im Hintergrund das Geräusch bin ich, wie ich “Fritz” an die Tafel schreibe.
Der wohl wichtigste Schnitt im gesamten Film und ein schönes Beispiel dafür, dass das Zusammenspiel aller Elemente viel mehr aussagen kann, als nur die Summe aller Teile. Hier beantworte ich die Frage nach dem “Warum”:
Ihre Mutter starb früh und sie ließ ein Kind einsam zurück. Die Einsamkeit und Traurigkeit von damals spiegelt die Einsamkeit von Nagoro und lässt vielleicht erahnen, warum sie seit 10 Jahren Puppen bastelt.
Kleiner Gag, den ich ganz gerne beim Wechsel von Foto auf Video mache. Im ersten Moment denkt man noch, es ist ein Foto, bis sich was bewegt.
Tatsächlich reagieren die Leute hier auch auf mich. Ich hab den Cut jetzt vorher gesetzt, aber sie winken mir im Video noch zu und signalisieren, dass ich das Peace-Zeichen machen soll.
Eine meiner Lieblingseinstellungen im gesamten Film. Man sieht, wie sie die Aufmerksamkeit sucht, aber durch ihr Schlucken sieht man auch, wie sie manchmal damit zu kämpfen hat immer das gleiche zu erzählen und ständig mit Fremden agieren zu müssen. Ich hab die Kamera einfach drauf gehalten, in der Hoffnung es passiert etwas. Es ist halt doch Glück manchmal.
Die Besucherin geht rechts aus dem Bild und im Rest des Film tauchen ab jetzt auch keine weiteren Personen mehr auf. Die Puppenfrau ist wieder alleine.
Bei den Filmen, die ich vorher gemacht habe, konnte ich oft beobachten, wie Leute nach Ende des Videos noch in den Bildschirm starren, weil sie das Gesehene noch verarbeiten. Das ist ein schöner Effekt und den wollte ich hier auch nutzen. Die Spannung, die aufgebaut wird, löst sich im Film nicht auf, es gibt kein konkretes Ende. Selbst in den Credits spricht sie noch weiter.
Die Credits sind irgendwie auch nur leere Namen und eigentlich nur für die von Bedeutung, die sie tragen. An dieser Stelle auch mal eine Auflistung:
Akari Matsumoto – Masterstudentin in Hiroshima. Sie gab mir die Tickets zum Shakuhachi Konzert, wo ein Verwandter spielte
Shikoku Electrical Power Inc. – Die Firma hinter dem Damm und Energie-Monopolist auf Shikoku
Ayano Tsukimi – die Puppenfrau
Yuki und Miki – siehe erster Eintrag.
Darunter sind die Namen von Yukis Eltern
Haruno und Moeko sind (ehemalige) Studenten aus Hiroshima mit sehr guten Englischkenntnissen. Sie haben die erste und zweite Version nochmal durchgehört, damit die japanischen Sätze auch Sinn machen. Machen sie zwar nicht komplett, aber die meisten verstehen es…
Und zum Schluss Michael Hauri von 2470media, von dem ich diese Art des Geschichtenerzählens gelernt habe und der nochmal vor der Veröffentlichung drüber geschaut hat.
Wie gesagt: Es geht nicht darum, dass der Zuschauer exakt so formulieren kann, was ich mir beim Schnitt gedacht habe. Es geht darum ein gewisses Gefühl auszulösen, einen Gedanken zu vermitteln ohne ihn auszusprechen.
Im letzten Teil geht es um der Veröffentlichungsgeschichte, wo es lief und wer es alles geklaut hat.