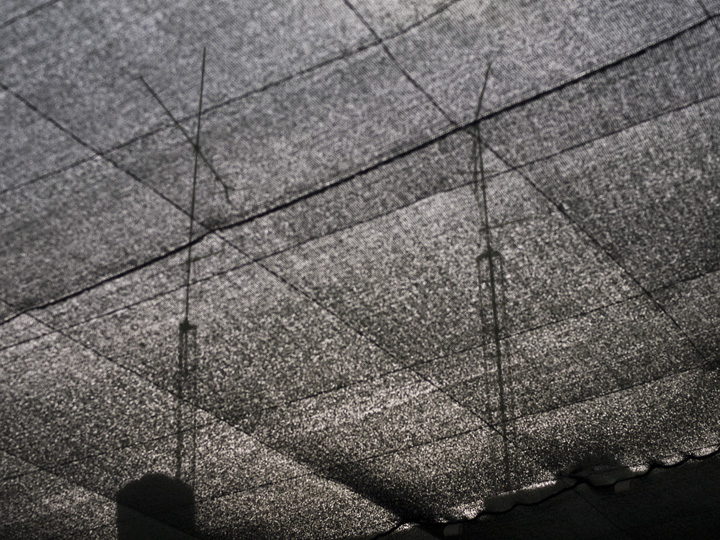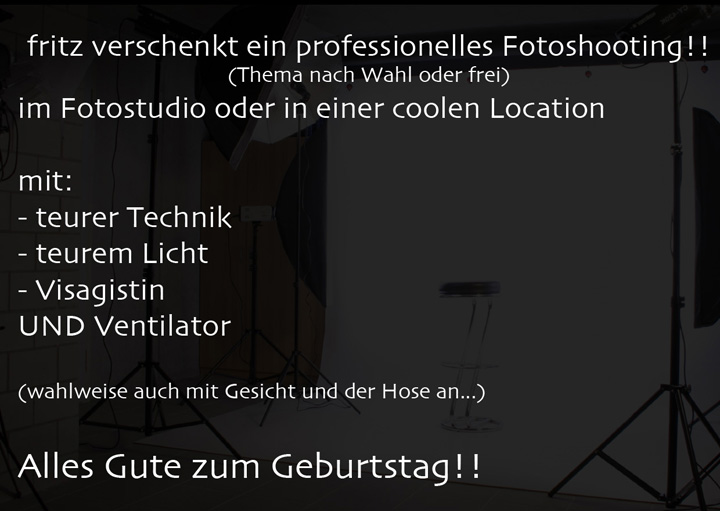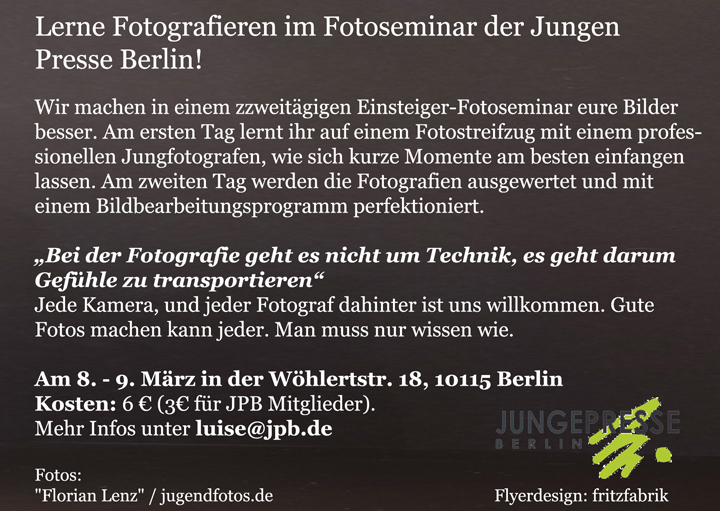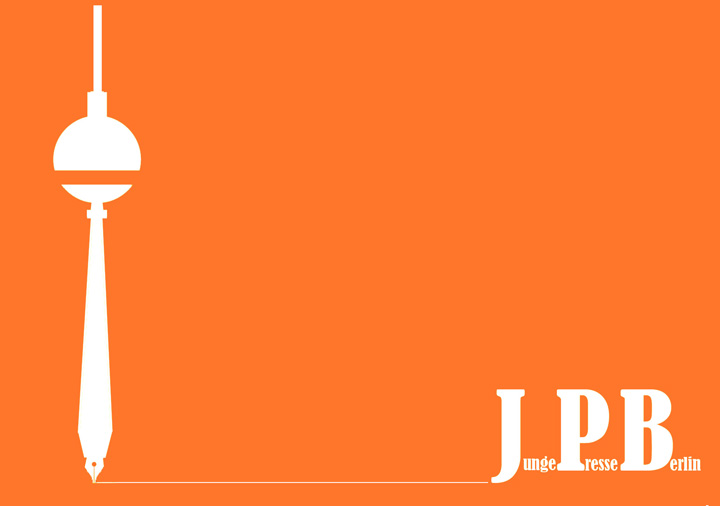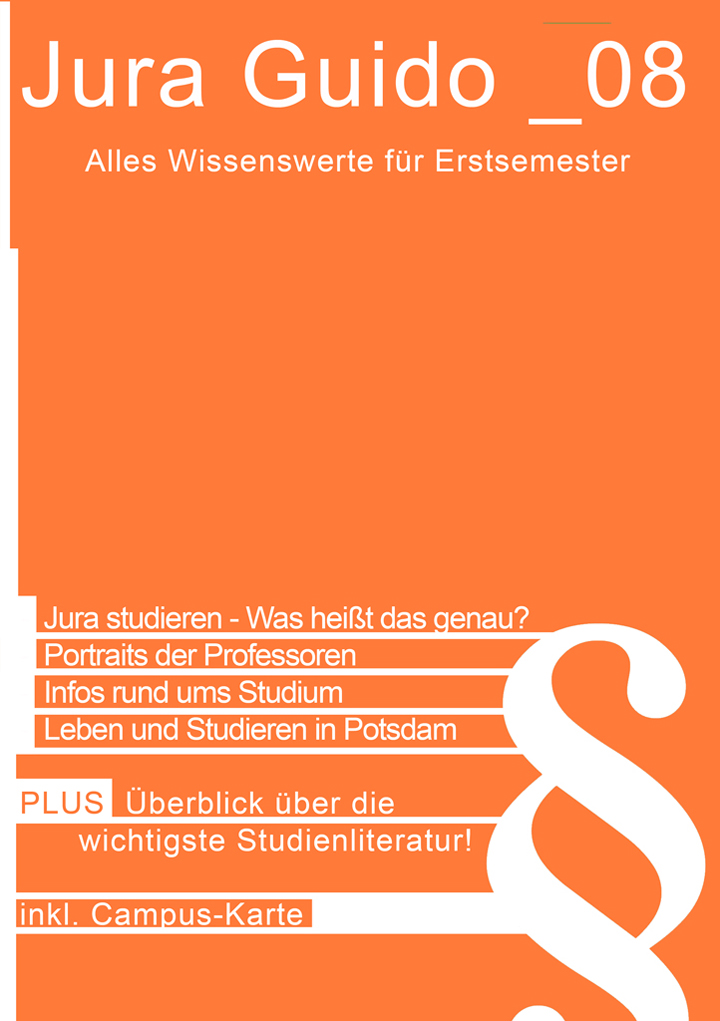Der zweite Tag in Palästina. Der erste Tag war lang, die Nacht mehr als kurz. Heute sollten wir also endlich mal wirklich die Orte sehen, statt nur einem Ausschnitt davon in einem Fenster. Viel Tageslicht hatten wir dafür nicht, denn die Nacht brach früh herein…

Nach ca. vier Stunden Schlaf wachte ich in Jeans und Shirt auf der Decke meines Bettes auf, die Brille noch auf der Nase und mein Notizbuch, in das ich bei meiner Ankunft am Morgen noch geschrieben hatte, lag neben meinem Kopfkissen. Irgendjemand sagte „Frühstück“ und ich wankte ins Badezimmer. Der erste Blick in den Spiegel.
Die schlechte Rasur vom Vortag wich schon den ersten Stoppeln. Von draußen scheinte hell und intensiv die Sonne auf die nicht mehr ganz so weißen Fliesen des Badezimmers. Ich spritzte mir etwas nicht trinkbares Leitungswasser ins Gesicht, bemühte mein Deo und stöhnte mein Spiegelbild an. Ich war im Arsch.
Wie ein Untoter schlurfte ich zum Frühstück in den zweiten Stock, ließ mich in einen Stuhl fallen und kaute mit glasigen Augen auf einem würzigen Stück Fladenbrot herum. Mein Kopf war irgendwie im Standby-Modus, noch dabei die intensiven Eindrücke vom gestrigen Tag zu verarbeiten. Sonst passiert das ja im Schlaf, dafür ist das Träumen da. Doch heute Nacht war dafür keine Zeit. Mein Geist funktionierte im Minimalbetrieb.
Kauen. Trinken. Schlucken.
Mit den anderen Reden war da schon zuviel verlangt.
Es blieb auch wenig Zeit, keine 20min später war schon das erste Projekt-Meeting für den Tag angesetzt, wo wir über die kommende Woche und die zu drehenden Filme reden wollten, und auch zum ersten Mal auf die palästinensischen Jugendlichen treffen sollten, die mit uns an den Filmen arbeiten sollten. Vorher mussten wir unsere Pässe abgeben, die Passnummern sollten an die „Touristen-Polizei“ gesendet werden, damit die wissen, wer sich hier gerade aufhält.
Ich habe keine Ahnung, wer oder was diese „Touristen-Polizei“ sein sollte, zumal es hier ja keine Touristen gibt. Aber auch wenn diese Passkontrolle etwas totalitär wirken sollte, so war es auch diese Abteilung der Polizei, die, falls wir Probleme haben sollten, auch für uns da wäre und uns beschützt. So wurde es uns von ehemaligen Besuchern dieses Orts erzählt, mit denen wir uns vor der Reise trafen.
Wir waren aber während unseres Aufenthalts nicht auf die Polizei angewiesen.
„Fritz, ich mach mir Sorgen um dich“, sagte mir jemand aus der Gruppe, den ich kaum ein paar Stunden kannte, aber schon in meinem Gesicht lesen konnte, das heute mit mir nicht alles stimmte. Ich gab ihr zwar Recht, das ich etwas matschig bin, aber erklärte auch, dass mein Gehirn noch damit beschäftigt ist, alles um mich rum zu prozessieren.
Da wir die zwei letzten waren, die ihren Pass abgaben, liefen wir den anderen zum Meeting hinterher, welches ein paar Häuser weiter in dem Garten des Cinema Jenin stattfand. Unter einer schwarzen Plane, die dem sonst verbrannten Rasen etwas Schatten spendete, stellten wir uns ein paar Gartenstühle aus Plastik zurecht und warteten.
Es folgte noch einmal eine kurze Zusammenfassung vom Projekt und was wir hier vorhaben. Als wir eintrafen waren noch keine palästinensischen Jugendlichen vor Ort, diese trudelten erst nach und nach ein. Über den Zeitraum von einer halben Stunde kamen wortlos mehr und mehr junge Leute hinzu, ohne eine Meldung über ihre Verspätung oder sonstiges. Für Deutsche, und Japaner ja auch, wäre das recht unhöflich. Doch im arabischen Raum, so hörte ich von mehreren Quellen, sind Verspätungen von bis zu einer Stunde in Ordnung und müssen nicht weiter kommentiert werden.
Die Vorstellungen fanden dann in Englisch statt und mussten stets übersetzt werden, weil die palästinensischen Jugendlichen dann doch nicht so fließend Englisch sprachen.
Es folgte auch Ringelpietz mit Anfassen – so nenn ich immer diese lustigen Kennenlernspielchen, die mich vom Freiwilligen Ökologischen Jahr bis hin zum Zivi verfolgten, und die ich immer sehr leidlich finde. Der absolute Overkill an diesen Spielchen hatte ich auf einer Seminarfahrt während des Freiwilligen Ökologischen Jahres. Die Fahrt dauerte damals zwar nur fünf Tage, doch bis zum letzten Tag gabs pro Tag mindestens drei dieser Kennenlernspielchen – auch wenn wir uns nach dem 6. Spielchen schon alle auswendig kannten.

Vom Garten sichtbar, eine Tür zur Straße hin, hinter der eine Fahrradwerkstatt war
Nunja, also machten wir nun diese Spielchen, stellte uns nach Schuhgröße, Anzahl Geschwister und Dickdarmlänge Alter auf. Dann noch einen Sitzkreis, in der sich jeder nochmal mit Namen vorstellt und ein Talent von sich preisgibt, stets mit Übersetzung. Als die Reihe an mir war, sagte ich, dass mein Talent ist, Japanisch zu sprechen, aber die Übersetzerin wusste nicht, was „japanese“ heisst, und ich wollte es auch nicht lange erklären.
…Japan liegt da hinten, Richtung Osten. Weit da hinten…
Dann ging es an die Arbeit: Ziel des Projektes war es, kleine Geschichten in Filmen zu der Region zu erzählen. Die ursprüngliche Idee war es, dass wir kleine Dreh-Teams bilden, jeweils noch mit einem Palästinenser zusammen und dann rausgehen zum Drehen. Das haute aber nicht hin, da wir nur zwei Palästinenser hatten, die fließend Englisch konnten: Ein mondänes, selbstbewusstes Mädel mit gelben, hochhackigen Schuhen und Kopftuch, und einen Selbstdarsteller mit Brille, der oft und viel erzählte, vor allem von sich, und dabei einen zusammengerollten Hefter wie einen Dirigentenstab führte.
Trotzdem sollten wir jetzt schon besprechen, was wir hier drehen wollen, und uns so dann in Gruppen zusammenfinden.
Ich hatte ein Problem mit diesem Ansatz. Denn weder kannte ich den Ort, noch wusste ich, was hier überhaupt passiert. Wie sollte man denn jetzt eine Geschichte konstruieren – ohne sie tatsächlich komplett zu konstruieren und inszenieren. Schließlich schreiben wir kein Drehbuch, indem die lokalen Akteure nur das Schauspiel ausüben, das wir Fremde aus dem Westen uns über sie ausdenken. Das ist kein Journalismus. Etwas frustriert zog ich mich aus den kleinen Debatten zurück.
Ich schlug vor, dass wir uns doch erstmal die Stadt anschauen sollten, bevor wir hier uns irgendwas ausdenken, was dann am Ende vielleicht garnicht funktioniert. Schließlich haben wir von Jenin nicht mehr gesehen, als die drei Häuser zwischen Gasthaus und Garten. Mein Vorschlag ging allerdings in der allgemeinen Diskussion unter. Verstummt setzte ich mich wieder auf meinen Plastikstuhl und verschränkte die Arme.
Auf einmal fragten mich zwei Mädels neben mir: „Fritz, magst du Frauen?“. „Klar“, sag ich automatisch. „Gut, dann kannst du ja bei unserer Gruppe mitmachen, mit dem Thema ‚Frauen'“.
Die beiden erzählten mir dann, was sie machen wollten. Sie hatten sich nicht viel ausgedacht, sie wollten einfach nur Frauen aus Palästina suchen, befragen und vorstellen. Ohne viel Dramatik, ohne konkrete These. Einfach eine nüchterne Betrachung von Frauen hier, fernab von Klischees und sonstigen Vorurteilen.
Dieser rein dokumentarische Ansatz überzeugte mich sehr und ich sagte zu. Zusammen waren wir zu dritt, zwei Mädels und ein Kerl. Ich selbst hatte mir kein Thema ausgedacht, da ich auch den Ort nicht kannte und mir auch nichts ausdenken wollte. Das, was mich überall interessiert, woher ich auch komme oder wohin ich gehe, ist junge Kunst. Dazu hätte ich gerne was gemacht, wussten aber nichts, ob es etwas dazu gibt. Auch gab mir diese Gruppe mit den zwei Mädels auch die Möglichkeit, mich mal darin zu üben, mich zurückzunehmen. Sonst bin ich es immer gewohnt, die Recherche komplett allein zu machen oder Projekte gesamt zu leiten. Indem ich mich jetzt mal zurücknehme, bekomme ich mal eine andere Perspektive. Zudem hatte ich auch so mehr Möglichkeiten Fotos zu machen.
Die Mädels boten mir dann noch an, zu versuchen eine junge weibliche Künstlerin zu finden, damit ich auch glücklich werde und mein Thema umsetzen kann.

Die Pali-Katze, die neugierig zwischen den Stühlen rumlief, schnell zutraulich wurde, und sich unter den Stühlen im Schatten entspannte
Die anderen Gruppen konstruierten weiter. Während die Palästinenser irgendwie alle ihre Probleme in einem einzigen Film erklären wollten, gab es noch etwas zu Rap und Hip Hop, und irgendwas mit Studium/Frauen/Leben…
Die Palästinenser wollten die eierlegende Wollmilchsau in Filmform. Das wir nicht alles in ca. 5min Beiträgen unterkriegen, vorallem nicht ohne zu inszenieren, war denen, die noch nie einen Film gedreht hatten, nicht klar. Wir konnten uns dann darauf einigen, dass sie ein Theaterstück schreiben, dass dann abgefilmt wird.
Doch nicht nur sie hatten vorher keine Erfahrung gesammelt, wie man eine Geschichte in einem kurzen Film erklärt. Fast alle hatten noch nie eine Filmkamera in der Hand. Ich schon, daher konnte ich mir ungefähr vorstellen, was funktionieren kann, und was nicht.
Die Gruppe, die Studium/Frauen/Leben machen wollte, hatte am Ende so viele Ideen, die insgesamt viel zu umfangreich waren. Die geheime Leiterin, die zwar nie offiziell gewählt wurde, aber so agierte und auch von allen so akzeptierte wurde, frustrierte in der ersten Recherche zu ihrem Thema vor dem Rechner. Da ich sie schon seit mehreren Jahren aus meiner Redaktion kannte, suchte ich natürlich das Gespräch – auch weil ich selbst schon die Erfahrung hatte, in einem fremden Land in kurzer Zeit eine Geschichte zu produzieren. Sie hörte meine Ratschläge, weigerte sich zuerst, doch sie nahm sie nach einer Überlegung doch noch an. Den Film, den sie am Ende machte, hatte sehr wenig mit der ersten Überlegung, unter der schwarzen Plane im Garten, zu tun.
Die HipHop Gruppe wollte ein Portrait über Rapper aus Jenin machen, diese begleiten und deren Musik zeigen. Auch wenn ich persönlich HipHop nicht mag und wenig Vertrauen in die Gruppe hatte, so war deren Film doch der, der mich am Ende am meisten beeindruckte und der am Besten von vorne bis hinten funktionierte. Er funktionierte, weil die Macher in der Gruppe ihre Leidenschaft für HipHop aus Berlin nach Palästina brachten und dort umsetzten. Es funktionierte auch, weil ihre Protagonisten reden konnten und reden wollten – nicht weniger machten sie ja auf der Bühne.
Die einzige aus unserer gesamten Gruppe, mit Filmerfahrung, war eine freie Dokumentarfilmerin. In unserer Woche in Palästina lief auch ein Film von ihr auf einem portugiesischen Filmfestival, welches es allerdings nicht für nötig hielt, sie deswegen auch zu benachrichtigen.
Diese Filmemacherin machte nun quasi ihre eigene Gruppe auf. Weniger weil sie mit den anderen nicht konnte, sondern weil es für ihr Thema nicht nötig war. Sie begleite jemand aus dem Gaza Streifen, der ohne Pass oder sonstige Dokumente im Krieg nach Jenin flüchtete und nun hier lebte, aber niemals legal eine Grenze wird passieren können, ohne die Behörden zu alarmieren, die ihn dann in den Knast stecken würden. Zuerst wollte er den Film auch nicht machen, aus Angst erkannt zu werden. Nach vielen intensiven Gesprächen mit der Filmemacherin unter vier Augen stimmte er allerdings zu.

Erste Recherche in den Gruppe, bzw. der erste Anruf über Skype zur Freundin daheim. Auch wichtig.
Unser Thema war also nun Frauen.
Die erste Recherche sollte beginnen und wir gingen zurück in unser Hostel. Da alle Rechner besetzt waren, und ich keinen eigenen hatte, überließ ich den Mädels die Aufgabe und zog mich mit Kopfschmerzen aufs Dach zurück, wo ich in einer Hängematte den Muezzins und dem Marktgeschrei lauschte. Ich versuchte wieder einen klaren Kopf zu kriegen, sperrte mit Musik dann doch die fremden Geräusche aus und zog mir den Stoff der Hängematte über die Augen, um auch den warmen Sonnenschein aus meinem Kopf zu halten.
Nach einer Stunde ging es mir wieder besser und ich nahm alles klarer war. Ich setzte mich zu meiner Gruppe und hörte mir die ersten Überlegungen an. Es gäbe wohl ein Frauenzentrum im Flüchtlingslager, dass wir besuchen könnten. Das selbstbewusste Mädel aus der Gruppe palästinensischer Jugendliche, die dort als einziges Mädel saß, wäre auch interessant. Dann vielleicht noch die Familie von einem deutschen Voluntär, die hier wohnt. Und dann noch vielleicht die Lehrerin, die hier im Hostel Deutsch unterrichtet, u.a. auch an palästinensische Frauen. Ich ergänzte noch, dass egal wen wir sprechen, das dann noch zu weiteren Kontakten und Interviewpartner führen wird. So kannte ich es aus Japan. Ohne viel Pläne, nur mit Namen und Adressen bereiteten wir uns auf den nächsten Tag vor. Viel mehr braucht es auch nicht an Recherche. Am ersten Tag eine Art Drehbuch schreiben zu wollen, ohne zu wissen, was einem die Leute erzählen, ist kein Journalismus.
Und Schwuppdiwupp war es dunkel und das Essen stand an. Ich hatte mich die Woche vorher in Berlin größtenteils von Fertiggerichten ernährt, dazwischen gab es nur den Kram im Flugzeug. Was uns jetzt hier auf großen Tellern mit einem Lächeln von einem schnauzbärtigen Mann serviert wurde, war das beste Essen in einer langen Zeit.
Ich weiss gar nicht mehr, was es gab, nur dass es gut war und ich das so noch nie hatte. Salate, Soßen und Reis auf großen Tellern, damit sich jeder seine Portion nehmen konnte. Und natürlich Hummus, Hummus, Hummus. Wir aßen draußen, bei immer noch sehr warmen Temperaturen, aber einer tiefen Dunkelheit bereits um 18 Uhr abends. Die Wespen, die ich auf den Tod nicht ausstehen konnte, hatte die Hitze leider nicht verbrannt und sie kamen jetzt rausgekrochen. Die Katze, mit der ich mich bereits beim Meeting am Mittag bekannt gemacht hatte, ließ sich einfach von mir rufen und gerne streicheln. Im Gegensatz zur deutschen Durchschnittskatze war sie hier recht dünn und immer auf der Hatz.
Das Essen, was wir dort hatten, ist immer so gemacht, dass man es zusammen mit diesem Fladenbrot isst, welches man einfach öffnen kann und so eine Brottasche ergibt, in die man dann alles füllt. Der deutsche Döner ist eine Form von diesem Brottaschen-Essen im arabischen Raum. Das Brot an sich ist relativ fad, auch wenn es stark gewürzte Varianten gibt. So bekamen wir auch dieses ungewürzte Brot zum Essen und kombinierten beides. Es war wunderbar.
Auch wenn man es schmeckte, dass das Gemüse nicht so knackig und geschmacksintensiv war, wie man es aus deutschen Supermärkten kennt. Fast etwas wässrig schmeckten die meisten Gemüsesorten, was mehrere Gründe hat. Zum einen sind die Sachen aus dem deutschen Supermarkt natürlich ziemlich überzüchtet, und im Vergleich mit dem intensiven würzigen Geschmack der Soßen und Pasten fällt das Gemüse auch weniger auf. Es ist aber auch so, dass all das gute Gemüse und Obst aus der Region nach Israel gehen. Nicht weil da jemand seine Macht ausübt, sondern weil es da einfach mehr Geld zu verdienen gibt.
Nichtsdestotrotz war alles gut und sehr lecker, und vorallem gesund! Doch genug vom Essen, beim Schreiben läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.
Nachdem der Koch mit Schnauzbart auch wieder mit einem Lächeln feststellte, dass es uns schmeckte, sollten wir nun endlich mal die Stadt sehen. Einer der palästinensischen Jugendlichen wollte uns seinen Ort zeigen, unser Übersetzer half ihm dabei.
Es war dunkel wie Mitternacht, die Straßen waren ähnlich leer, doch die Uhr zeigte gerade einmal 19 Uhr an. Mit unserer Gruppe, in der fast alle Mädchen blond waren, zogen wir viele Blicke auf uns. Die Mädels kleideten sich zwar alle sittsam, mit Tuch um den Kopf und langen Ärmeln, doch wer sein Leben lang nicht jeden Tag das Kopftuch bindet, der weiss eben nicht, wie man alle Haare darunter verstecken kann. Blonde Zöpfe und Strähnen blitzten immer wieder hervor. Allerdings hatten wir keine Repressalien zu erdulden, es bespuckte uns keiner oder beschimpfte uns, weil wir unsittlich angezogen waren. Einmal meinte unser Stadtführer, dass bei einer Dame etwas zu viel Ausschnitt ist, doch das war in so einem normalen Tonfall gehalten, wie man hier jemanden sagt, dass seine Schnürsenkel offen sind.
Viele, an denen wir vorbei liefen, die vor ihren Läden saßen und abends noch süßes Gebäck oder süße Drinks verkauften, sprachen uns auf Englisch an. Ein bis zwei sogar auf Deutsch. Das häufigste war ein ehrlich fröhliches „Welcome to Jenin“, am zweithäufigsten war allerdings nicht „How are you?“ oder „Where are you from?“ sondern „What’s your name?“. Manchmal gab ich ihn dann raus, aber so oft wie gefragt wurde, konnte ich garnicht erklären, wie man „Fritz“ denn nun ausspricht.

Coca Cola auf Arabisch. Von den vielen viel zu süßen Getränken hier war Cola noch mit am bittersten
Unser Übersetzer, der sich ja auch mit ihnen auf Arabisch unterhalten konnte, sagte etwas, was das Verhalten der Leute ganz gut beschreibt:
Jenin ist eine lebendige Stadt, die Leute wuseln durch die Gegend, jeder kennt jeden. Sie quatschen, sie tratschen. Sie diskutieren ewig, um sich zu vertagen. Sie haben nichts, aber viel Zeit. Zeit, um über sich selbst, ihre Umgebung und ihren Platz in der Welt nachzudenken. Alle wollen, aber nichts ist da.
Die Stadt ist Touristen nicht gewöhnt, denn es gibt wenig, was Touristen interessieren könnte, Sehenswürdigkeiten oder ähnliches. Die wenigen Sehenswürdigkeiten klapperten wir dann allerdings ab. Zum Beispiel ein Platz, an dem eine Pferdestatue aus Altmetall steht. Die Statue steht vor dem Eingang zum (ehemaligen) Flüchtlingslager, in das uns eingeschärft wurde nachts nicht reinzugehen. Eine von uns traute sich trotzdem, wenn auch eher unabsichtlich, und wurde energisch zurückgepfiffen.
Es war nacht, also auch dunkel. Ich ließ die Kamera schon die ganze Zeit in der Tasche, da es eh zu düster war, etwas anständiges abzulichten. Zudem wollte ich die Stadt erstmal auf mich wirken lassen, bevor ich ihr Momente mit der Kamera wegnehme.
Die Hobbyknipser aus der Gruppe, die beim Pferd alle ihre Kompaktknipsen rausholten, kümmerten solche Gedanken wenig. Es wurde das Pferd zu Tode geblitzt, ohne das etwas Brauchbares rauskam. Die Jugendlichen unterm Pferd, die uns erst neugierig betrachteten und dann für die Blitze posierten, freute das alles sehr.
Und dann fuhr ein Laster mit 10-14 Kindern auf der Ladefläche Richtung Flüchtlingslager. Ein Kindertransporter, mit vielen winkenden Händen und kleinen lächelnden Gesichtern in der Dunkelheit.
Hier an dem Platz mit dem Pferd wurde 2005 auch ein 12 jähriger Junge von der israelischen Polizei erschossen, weil er ein Spielzeugwaffe in der Hand hatte.
Die Organe vom Kind wurden vom Vater nach längeren Überlegung und Absprache mit einem zuständigen Geistlichen zur Spende freigegeben und rettete somit die Leben mehrer Kinder, darunter auch ein Kind aus Israel. Davon handelt auch der durchaus sehenswerte Film „Das Herz von Jenin“.
Weiter durch die Stadt kamen wir an einem Tor vorbei, hinter dem nur weiteres Nichts und Brache war, allerdings bewacht von zwei Uniformierten. So wie sie da saßen und mit ernster Miene und dicker Bewaffnung ein großes Tor voller Leere bewachten, gab es ein wunderbares Motiv – wäre es nur nicht so dunkel gewesen. Ich musste nicht meine Kamera rausholen, um das schon vorher zu wissen, also ließ ich sie drin. Ein Hobbyknipser aus unserer Gruppe, der schon öfter meinte mir erklären zu müssen, wie Fotografie funktionierte, hielt allerdings drauf. Uns wurde vorher gesagt, dass es schwierig ist, Uniformierte abzulichten, weil es da unabsehbare Konsequenzen geben kann. So sollte es auch hier sein.
Bevor er abdrückte wurde er schon zu den Uniformierten bestellt. Ein anderer Kerl von uns, der ebenfalls seine Kamera draussen hatte, ebenso. Sie wollten nur um die Erlaubnis für ein Foto bitten, doch es sollte komplizierter werden. Unser Übersetzer musste nun rüber und klären, während ich mit den Mädels auf der anderen Straßenseite wartete, wo ein Klamottengeschäft war, der an diesem Abend einigen Umsatz machte.
Nach mehr als 10min Gerede gab es immernoch keine Bewegung. Ich wollte mir selbst ein Bild machen, wurde aber recht ernst vom Übersetzer wieder zurück geschickt, da mehr Leute alles nur noch komplizierter machen würden. Anscheinend wurde von den zwei Uniformierten ihr Vorgesetzter angerufen. Ich weiss nicht, wieviele Ebenen das noch hochging, aber irgendwann gab es das Okay und die Wachmänner posierten mit ihren Waffen sogar noch vor dem leeren Tor für die Kameras.
Die beiden Hobbyfotografen kamen dann wieder zurück und meinten, das Foto ist nichts geworden. Es war wohl zu dunkel.
Ach, sag ich.
Ja, sagt er, und wir gingen weiter.
Wir kamen vorbei an einem Denkmal für ein im 1. Weltkrieg abgeschossenes deutsches Flugzeug, ein steinernes Monument mit Original Holzpropeller vorne dran.
Ob wir in eine Bar wollen, fragte unser Stadtführer. Wobei „Bar“ nichts ist, wo man Alkohol bekommen hätte, im Islam ja nicht gestattet. Es gibt dann nur süße und intensive Fruchtcocktails. Wir einigten uns aber auf arabischen Tee und gingen zu einem Lokal, vorbei an der dritten Sehenswürdigkeit der Stadt: Eine Art Nachbau einer alten Festung, mit steinern Kanonen davor. Ich hab das Monument nicht ganz verstanden, vielleicht irgendwas mit Kreuzzug, Befreiung, Belagerung, oder Sieg. Das Übliche eben.
Der „echte arabische Tee“ kam in einem Glas mit Lipton-Teebeutel, „Yellow Label“. Die Sorte Tee kannte ich aus Japan, weil es dort der billigste war und ich mich mal wochenlang davon ernährte (99yen die Box). Er war mir noch in Erinnerung, als Heissgetränk ohne eigenen Geschmackscharakter, einfach mit „Tee“-Geschmack. Ich erwartete nicht viel, trank aber trotzdem und war sehr überrascht. Denn den Geschmack vom arabischen Tee macht nicht das Zeug im Beutel aus, sondern die Kräuter und Gewürze, die neben dem Beutel im Glas schwimmten. Der Teebeutel bildet nur eine Basis, den Geschmack liefern die anderen Zutaten. Diese machten den Tee auch sehr süß und es war ein Fehler, ihn wie üblich vorher zu süßen. Aber ein wirklich ausgezeichneter Tee.
Ein Junge kam dann mit einem Handkarren angefahren, stellte sich etwas abseits von uns auf die Straße, aber immer mit klaren, wartenden Blick auf uns und versuchte uns Mangos zu verkaufen. Uns war nicht nach Mango.
Danach hatten wir fast schon alles gesehen, was sehenswert war. Zumindest bei Nacht. Und auch wenn es noch nichtmal 20 Uhr hatte, waren kaum noch Leute auf der Straße, keine Autos und kein Lärm. Zurück im Hostel wendeten sich die anderen Gruppen wieder ihren Themen zu, was bei großer Gruppe und vielen unterschiedlichen Vorstellung zum Thema länger werden konnte. Ich nahm mir mein Stativ und ging aufs Dach.
Ich hatte mein Stativ nur mitgenommen, weil ich hoffte, den Sternenhimmel über Palästina abzulichten. Dieser Abend war allerdings diesig und bewölkt.
Mit Sternen war da nix. Ich merkte beim Aufklappen auch, dass das Stativ etwas kaputt war. Eine Fixierungsverbindung war durchgebrochen, wird wohl beim Flug passiert sein. Ich hatte das Stativ in Japan von jemanden geschenkt bekommen und mit dem Flieger dann nach Deutschland gebracht, doch irgendwo zwischen Istanbul und Tel Aviv wird wohl einer zu hart meinen Rucksack umhergeschmissen haben. Naja, es stand noch, und mehr musste es ja nicht.
So konnte ich auch ein Panorama der Nacht machen.

Leere Straßen wo am Tag Leben und Handel tobt.
Auf einmal merke ich, wie mich jemand aus der Hängematte ruft. Allerdings rief sie mich „Früüöööhtz“, so wie ich immer gerufen werde, wenn ein „kannste mal ein Foto machen?“ hinterher geschoben wird. Mit zwei ‚ü‘ und drei ‚ö‘.
Klar doch, sag ich.
„Das is voll schööööhn“. Gesprochen mit deutlich hörbaren vier ‚ö‘ und einem ‚h‘, es gefiel also.
Es kam dann noch ein Mädel aufs Dach, während ich weiterhin die Sterne suchte.
Es entbrannte dann eine Diskussion über den Dokumentarfilm „Die Bucht“ („The Cove“), der von einer regelmäßigen, „traditionellen“ Abschlachtung von Delfinen in Japan handelt. Ich kannte den Film, ich teile dessen Kritik, allerdings gab ich auch meinen Standpunkt als Journalist, der ein Jahr in Japan gelebt und gearbeitet hat, wieder.
Im Film versuchen ein paar Amis diese Schlachtung von Delfinen in einer Bucht zu filmen und bekommen ständig Absagen von offizieller Seite. Sie beschließen dann in einer hoch dramatisierten Weise das ganze geheim zu filmen. Wie sie aber versuchen, diese Erlaubnis zu bekommen, ist diletantisch und einfaches Mittel zum Zweck, um den Film mehr Dramatik zu verleihen. So wird zum Beispiel keiner bemüht, der Japanisch kann, sondern es wird nur stumpf und emotional auf die Vertreter der Behörden in amerikanischen Englisch eingeredet. Das die kaum was verstehen weiss jeder, der mal versucht hat eine Erlaubnis von japanischen Behörden auf Englisch zu bekommen. Ich habs mehrmals versucht und es funktioniert nicht. Sobald ich dann aber auf Japanisch meine Anfragen schickte, funktionierte es. Doch die Darstellung von unflexiblen Japanern funktioniert ganz gut für diesen Film.
Vor diesem Hintergrund kann ich das „Wie“ des Films nicht ernst nehmen, finde aber das Thema sehr richtig und wichtig.
Allerdings kocht das Ganze dann schnell emotional hoch, mit „die Japaner fischen und essen ja eh alles“, ab und noch ein „Walfang!!!“ eingeschmissen und „du nimmst die ja nur in Schutz, weil du ein Jahr dort gelebt hast“. Emotional kann man keine Diskussion führen und irgendwann kam auch der Punkt wo für mich alles gesagt war und ich nichts mehr ergänzen wollte. Meinen Standpunkt konnten sie zwar verstehen, aber nicht teilen, doch mehr muss auch nicht. Eine Diskussion unter Erwachsenen, wie es sie in dieser Woche noch ein paarmal geben sollte. Angenehm und anregend.
Es kam dann noch jemand aufs Dach, der etwas Frust hatte und schon am ersten Tag ein Fazit vom Projekt ziehen musste. Ein paar seiner Kritikpunkte teilte ich, auch wenn ein Mädel dann korrekt anmerkte, dass heute doch gerade mal der erste Tag ist und wir Vertrauen haben sollten. Das sah er und ich ein. Und während er sich in die Küche zurückzog, wollte ich nur noch ins Bett.
Gerade einmal 10 Uhr abends war ich der erste in unserem Achtbettzimmer. Nach einer überfälligen Dusche unter Wasser, dass ohne wirklichen Druck in der Leitung nur langsam und kalt tropfte, legte ich mich ins Bett. Wieder nahm ich mir die Zeit, alles von heute aufzuschreiben.
Es war der erste richtige Tag in Palästina. Morgen sollten wir schon anfangen zu drehen und auch meine Fotokamera sollte intensiv zum Einsatz kommen. Ich schloss den Akku an den Strom an, stellte meinen Ipod auf Symphonie, und schlief bei laufenden Ventilator ein.
———
Post aus Nah-Ost:
Teil 1 – Die Straße nach Palästina
Teil 2 – Wie Tag und Nacht
Teil 3 – Der Tag der kaputten Kameras
Teil 4 – Männer müssen draußen bleiben