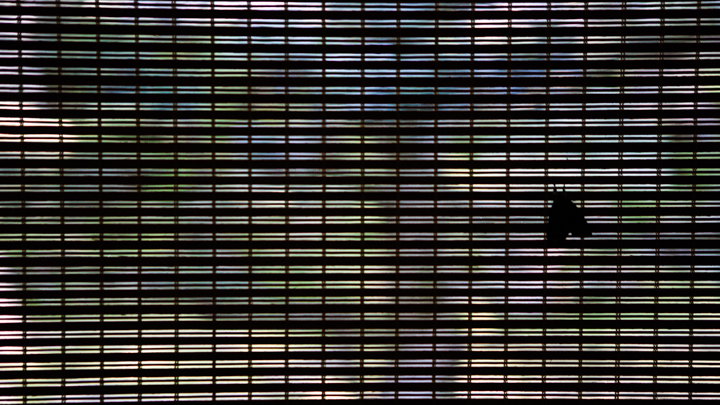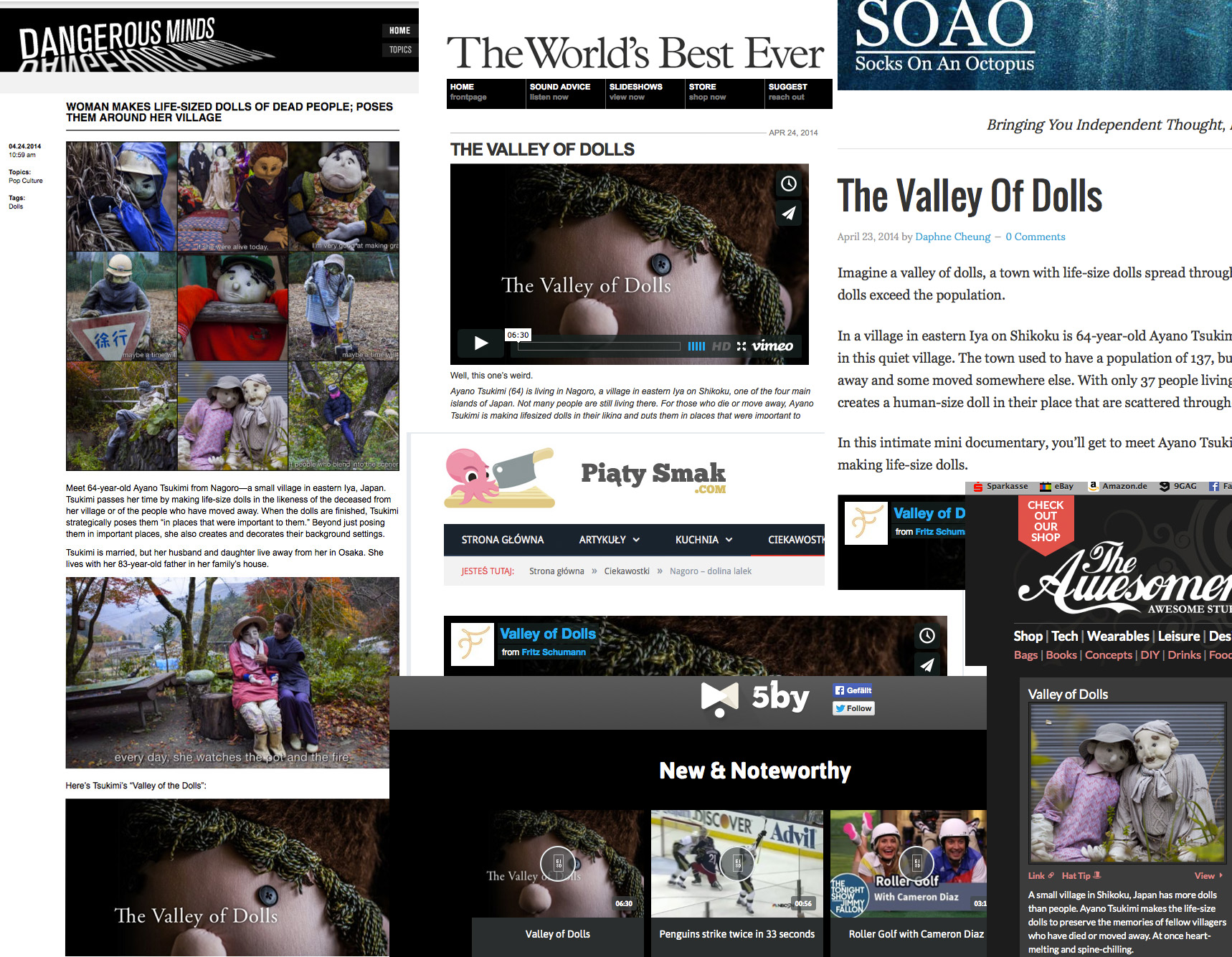1,300 Jahre Geschichte, 46 Generationen, sechs Drehtage und knapp 1.000 Euro Budget. Die Arbeit an dem Film brachte mich an die Grenze meine körperlichen und mentalen Belastbarkeit.
Mehr Szenen und Bilder aus, sowie die Geschichte hinter „Houshi“

Hinweis: In diesem Eintrag zeige ich neben den Fotos auch animierte Sequenzen. Die kurzen Videos müssen einmal kurz angeklickt werden, laufen dann aber in einer Endlosschleife. Bewegt man den Mauszeiger vom Clip weg, ist die Illusion perfekt.
Gedreht hatte ich „Houshi“ erst 2014. Gehört hatte ich von dem alten Hotel aber schon 2012. Wie die Puppen landete es auf meiner Liste von „Themen, die man mal machen könnte, wenn Geld und Zeit da sind“. Diese Liste ist zwar nicht so lang, wie man denken könnte, aber es sind auf jeden Fall viele Geschichten dabei. Ich denke es ist auch ein guter Filter, wenn ein Thema in der Liste ist, aber trotzdem noch Jahre später mein Interesse wecken kann. Das zeigt nur, dass die Geschichte stark ist.
November 2013
Die Puppen waren abgedreht und ich war wieder in Hiroshima. Damals hatte ich noch keinen eigenen Arbeitsraum und hing daher ständig bei Miki und Tomomi im CAT rum. Ein sehr entspanntes Zimmer, mit einer kleinen aber ausführlichen Bibliothek und Blick auf den Wald hinter der Uni. Manchmal konnte man Wildschweine sehen.
Miki und Tomomi waren beide zuvor ein Jahr in Hannover und wir halfen uns immer gegenseitig beim Lernen der Sprache des jeweils anderen. Beide konnten auch meine Emails Korrektur lesen, wenn ich wieder eine Anfrage schreiben musste.
Mit den Puppen abgedreht aber noch nicht geschnitten überlegte ich, welche Geschichte folgen kann. Ich bin mit vier Themen nach Hiroshima gekommen, eine war also schon fertig. Eine Geschichte fiel ins Wasser, weil ich keine Erlaubnis bekommen konnte. Eine andere wurde immer größer je mehr ich recherchierte. Und das letzte Thema verschob ich auf mehreren Monate. Also fing ich mit einer neuen Geschichte an. Houshi.
Ich wollte unbedingt den Winter nutzen um ein Hotel zu zeigen, dass seit Jahrhunderten wie in der Zeit festgefroren war. Die Zeit drängte also.
Meine erste Anfrage auf Englisch wurde ignoriert. Meine zweite Email auf Japanisch, die Miki mit viel Seufzen und Kopfschütteln korrigierte, kam durch. Man war bereit für einen Dreh. Meine Hoffnung, dass sie mir die Zimmerpreise erlassen, wurde leider nicht erfüllt. Aber die Familienmitglieder würden mir alle Interviews geben, die ich führen möchte.
Es ging dann noch eine Weile hin und her, Termine wurde verschoben oder kurzfristig abgesagt. Inzwischen tippte Miki komplett alle Mails für mich. Ich wollte sie als Übersetzerin eh mit ins Hotel nehmen und ihre Augen funkelten bei dem Gedanken an ein Onsen.
(Hiroshima ist zwar durchaus eine lebenswerte Stadt, aber mit heissen Quellen ist es wahrlich nicht gesegnet)
Irgendwann im Januar kam auf einmal eine Mail auf Englisch zurück. Sie stammte von Naomi.
Naomi arbeitet zwar nicht direkt fürs Houshi, übersetzt aber immer Mails mit Anfragen aus dem Ausland. Wie ich später erfahren sollte, hat Naomi drei Kinder, ein eigenes Geschäft und studiert noch nebenbei. Naomis Antworten kamen also immer schleppend.
Der Schnee schmolz wieder, aber noch kein Bild im Kasten.
Der Turning Point
Februar 2014 war eine entscheidene Zeit für mich in Japan. Mein Stipendium lief aus und es sah lange Zeit so aus, als würde es nicht verlängert werden. Mein Visum war zwar noch lange gültig und auch die Uni erlaubte es mir, zu bleiben. Doch das Geld wurde langsam knapp. Neben Houshi hatte ich ja noch andere Geschichte, die ich gerne machen würde. Doch leisten konnte ich sie mir nicht mehr. Selbst die 50 Euro Miete im Studentenwohnheim waren nicht gesichert.
Ende Februar kam dann die Nachricht. Ich kann mich noch sehr genau an den Tag erinnern. Der Himmel war wolkig, aber es sah nicht nach Regen aus. Google hatte mir die Tage zuvor immer vom Regen erzählt, also schleppte ich stets einen Schirm mit. Diesmal verzichtete ich drauf.
Kaum stand ich an der Bushaltestelle, ging es los. Wolkenbruch. Aber heftig. Ich fror im nassen Wind und wurde klatschnass. Ein junger Mann hatte Mitleid mit mir und bot mir seinen Schirm an.
In der Stadt saß ich dann wenig später im San Marco in der Hondori, einer Art Starbucks in Japan. Hier war ich jede Woche und arbeitete, wenn die Uni geschlossen war oder ich mal einen Ortswechsel brauchte. Ich hatte den Rechner aufgebaut und schnitt am Video zu den Puppen. Die Hose war immer noch nass. Am Abend dann die Email. Meine Bewerbung wurde bewilligt, das Stipendium verlängert. Ab jetzt noch einmal 1.000 Euro pro Monat bis August!
Diese neue Möglichkeit brachte auch eine Verantwortung mit sich. Ich würde fortan an mein Geld nur noch in meine Filme stecken und ansonsten sparen wo ich kann. Bis August waren es noch sechs Monate. Wenn ich alle Geschichten schaffen möchte, muss ich meine Zeit und mein Budget straff einteilen.
Mein Professor in Hiroshima freute sich auch über mein Stipendium und fragte gleich, was ich damit vorhabe. Ich erzählte ihm von meinen Projekten und er bat mich, die mal der ganzen Fakultät vorzustellen. Auf Japanisch.
Einige Wochen später hing dann dieser Aushang überall in der Universität.

Der hing da sogar bis September, als ich ging
April bis August 2014 war die intensivste, spannendste, anstrengendste, aber auch erfüllendste Zeit, die ich je erlebt habe. Ich arbeitete an drei Filmen, gleichzeitig und parallel, 10 bis 12 Stunden jeden Tag. War ich nicht unterwegs und drehte, bereitete ich Drehtermine vor oder sichtete Material. Nach langen Einreden auf meinen Professor bekam ich nun auch endlich einen Ausweis, um auch am Wochenende die Uni zu betreten. Den Arbeitsraum für Austauschstudenten, der zuvor nur Abstelllager war, räumte ich auf und richtete ihn ein. Ich machte ein kleines Kino daraus, wo wir Austauschstudenten fremde Filme schauten. Es gab nie eine produktivere Zeit in meinem Leben.
Da ich aber immer in mehreren Projekten gleichzeitig denken musste, war die Zeit auch teilweise sehr anstrengend. Ich war oft müde und schlief schlecht. Ich fing damals an, zu Mitternacht, wenn die Arbeit beendet war, den Berg rauf und runter zu joggen. Das half. Und es half natürlich auch die Projekte abzuschließen.
Erster Dreh und erstes Projekt war Houshi. Drehtermin: Anfang April 2014.
Bei Miki, die ich eigentlich mitnehmen wollte, gab es auch eine große Veränderung. Sie war fertig mit der Uni und wechselte für ihren Master ins 400km entfernte Gifu. Ihr letzter Tag in Hiroshima war der Abend bevor ich zum Houshi aufbrechen sollte. Die Präfektur Gifu liegt zwar direkt neben Ishikawa, wo das Houshi Ryokan sich befindet, aber sie kam leider nicht mit mir. Den letzten Abend wollten wir aber noch zusammen verbringen. Auch gerade deswegen, weil sie vorher mir noch die Fragen für die Familie übersetzen wollte.
Vor ihrem Haus parkte ein großer silberner Umzugswagen mit einer schwarzen Katze drauf. Miki ist DJ und ihre ganzen Platten, die teilweise aus Deutschland stammten, mussten nun irgendwie nach Gifu. Gegen 22 Uhr war der Wagen voll, die Wohnung aber noch nicht leer. Hilft halt nix, sagte sie, und bestellte den Laster nochmal für die nächste Woche.
Miki wohnte in einem alten japanischen Haus auf der anderen Seite der Hügelkette auf dem die Universität gebaut war. Es fuhr dort keine Bahn, das machte die Miete billig. Mein Taxi von der Uni brauchte 30 Euro bis es bei ihr war.
Selbst im April kroch die Kälte an diesem Abend in die Reismatten. Miki machte mir den Heiztisch an und ging in die Küche. Pommes machen. Seit ihrer Zeit in Deutschland steht sie tierisch auf Pommes. Zu ihrem Abschied schenkten wir ihr auch eine kleine Fritöse, für ihr Zimmer im Studentenwohnheim in Gifu. Die stand jetzt noch in der Verpackung in ihrem halbleeren Zimmer, weil es nicht mehr in den Laster passte.
„Fritz, ich kann den Sake nicht mitnehmen. Den müssen wir heute trinken!“
Der Abend mit Pommes und Sake war tatsächlich sehr lustig. Wir haben die halbe Nacht übersetzt und Aufzeichnungen von japanischen Popsternchen geschaut. Miki konnte stets mittanzen und -singen, ich schlief irgendwann mal gegen 4 Uhr erschöpft ein.
Wir beide mussten am nächsten Morgen den Zug Richtung Osten erwischen. Unsere Wege trennten sich am Hauptbahnhof Hiroshima. Sie nahm den schnellen Shinkansen, ich die langsamen und billigen Regionalzüge. Keine zwei Stunden später war Miki schon in Gifu, ich war erst am nächsten Tag in Ishikawa. Die Nacht verbrachte ich im Internetcafé in Kyoto.
Ankunft in Awazu
„Hallo, hier ist Journalist Fritz Schumann. Sie erwarten mich.“ Wie vorher abgesprochen sollte ich anrufen, wenn ich am Bahnhof ankomme. In der einen Hand jonglierte ich das Handy, in der anderen die Kameratasche. Bei meinem ersten Anruf in holprigen Japanisch wurde gleich aufgelegt. Bei meinem zweiten Anruf bot man mir jemanden an, der Englisch kann. Der konnte jedoch nur „Herro?“ und das wars. Jetzt legte ich auf. Beim dritten Anruf sagte ich einfach nur „Hallo, ich bin Gast bei Ihnen, können sie mich abholen?“. Das klappte.
Eine halbe Stunde später stand ein älterer Herr mit Brille vor mir. Das Logo auf seiner Schürze erkannte ich. Ich zeigte auf seinen Schritt, vor dem die Schriftzeichen aufgedruckt waren, und fragte „Houshi?“ Er nickte wortlos.
Im Auto war er wenig gesprächig und konnte nur allgemeine Phrasen zu Bergen und Baseballstadien der Umgebung loswerden.

Ein spezieller grüner Tee, der sehr bitter ist, wird zur Begrüßung gereicht, während die Angestellten das Gepäck aufs Zimmer bringen.
Es war 14 Uhr als ich verschwitzt die große Eingangshalle betrat. Unisono begrüßten mich ein Dutzend weibliche Angestellte im Kimono. Und zwar nur mich, ich war der einzige Gast um diese Uhrzeit.
Erst jetzt wurde mir klar, was für ein Luxushotel das Houshi sein musste. Das ich Journalist bin und hier einen Film mache, wusste keiner der Angestellten. In meinem ungebügelten Shirt und den ungekämmten Haaren machte ich auch sicher nicht den Eindruck eines Profis.
Ich war alleine, Ausländer und unter 50 – solche Gäste gibt es im Houshi mehr als selten. Aber man lächelte und stellte eine deutsche Flagge auf den Tresen.
Bevor ich mit der Familie reden konnte, nahm mich einer der Manager beiseite. Er wollte noch einmal von mir hören, was ich denn genau hier vorhabe. Etwas aufdringlich bat er mich, doch alle Fotos, die jetzt hier entstehen, dem Houshi kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ich stimmte erstmal zu, ohne dass ich mich auf diesen Deal einlassen wollte.
Shou, einer der drei chinesischen Angestellten, brachte mich zu meinem Zimmer. Er hatte mehr als nur einen Namen, aber Shou war der einzige, den ich sagen konnte. „Den Namen benutze ich für die Japaner. Ist einfacher auszusprechen.“ sagte er mir.
Mein Zimmer war eines von denen, die 300 Euro die Nacht kosten. Shou war für die nächsten drei Tage allein für mich zuständig. Das gehört dazu, wenn man das Zimmer bucht.
Der Raum war kleiner als ich dachte. Aber ich hatte schon schäbiger gewohnt. Und größer als ein Zimmer in Tokyo ist es alle mal. Dann ging Shou an mir vorbei und schob die Wand auf. Ich befand mich erst im Vorraum, das eigentliche Zimmer, mit Blick auf den Garten, war dahinter.
Ich habe nie teurer gewohnt.
Ich schmiss Rucksack, Kamera und Kabel auf den Boden und brauchte erstmal eine Dusche. Shou meinte, ich solle doch lieber direkt in die heisse Quelle springen. Auch in meinem Zimmer kommt das Wasser der Quelle aus dem Hahn. Er fragte mich noch, wann ich denn speisen möchte, was ich zunächst aber nicht verstand. Er benutzte ein sehr altes, höfliches Wort für Abendmahl, was ich nicht kannte. Erst als er es simpler formulierte „Wann willste essen?“ konnte ich ihm 18 Uhr sagen und endlich duschen.
Die Interviews waren erst am nächsten Morgen. Vorher konnte ich nicht viel machen und nahm mir die Zeit, das Hotel erstmal auf mich wirken zu lassen. Die Größe, die Geschichte, die Preisklasse – all das realisierte ich erst jetzt. Ich wusste gar nicht, wo ich mit der Kamera anfangen sollte. Wie sollte ich alleine die 1,300 Jahre einfangen?
Doch vorher erstmal essen.

In dieser Preisklasse wird das Essen vom eigenen Butler Angestellten auf das Zimmer gebracht. Sein Zimmer, in dem er das Essen vorbereitet, liegt direkt auf dem Flur gegenüber. Von dort bring er die Schüsseln, Teller, Fäßchen mit Spezialitäten. Alles köstlich.
Normalerweise sind zwei oder mehr Gäste beim Essen im Zimmer. Ich war alleine. Der Angestellte ist dazu verpflichtet, beim Essen im Zimmer zu bleiben. Er sitzt neben dem Tisch und beobachtet. Die Idee ist, dass er bei der kleinsten Unzufriedenheit, oder wenn Reis, Wein, Wasser fehlen sollte, sofort eingreifen kann, bevor der Gast auch nur die Chance hat einen Wunsch zu äußern. Eine extreme Form der Höflichkeit.
Da saß ich nun also, irgendwo in Ishikawa, vor meinem 300 Euro Zimmer tanzen die Koi-Karpfen im 400 Jahre alten Garten und ein Chinese guckt mir beim Essen zu. Ihm war das nicht annährend so unangenehm wie mir. Ich fing also an, mit ihm zu plaudern. Was sollte ich auch anderes tun.
Shou ist so alt wie ich und seit einem Jahr im Houshi. Ihm gefällt es ganz gut, auch wenn die Arbeit manchmal anstrengend ist. Ein paar Brocken Englisch kann er auch, die er aber wohl in amerikanischen Filmen gelernt haben musste. Manchmal begrüßte er mich im Hotel mit „Howdy Fritz“.
Ein chinesischer Cowboy im japanischen Hinterland.
Das Abendmahl ging eine Stunde und er hörte nicht auf immer wieder neues Essen zu bringen. Irgendwann schmiss ich ihn dann höflich raus, schaute mir noch die neue Folge von Game of Thrones an und ging früh ins Bett. Am nächsten Tag wollte ich als erstes den Sonnenaufgang vom Hoteldach filmen.
5 Uhr früh, übermüdet und im Halbdunkel schälte ich mich aus dem Futon. Ich sammelte die Kamera vom Boden auf und bereitete den langen Tag vor. Eine Liste der Motive war verstaut neben dem Teleobjektiv. Mit einer Dose CC Lemon ging es aufs Dach.
Es war frisch, doch die ersten Sonnenstrahlen machten es ganz angenehm. Nebenan auf einer uralten Baumkrone hockte eine ganze Schar von Vögeln.
Die Sonne beeilte sich dankenswerter Weise und ich konnte schnell runter zum Frühstück. Shou hatte schon alles aufgebaut. Da ich echt kein Morgenmensch bin, bat ich ihn, mich alleine zu lassen. Das Frühstück war weniger ausführlich als das Abendmahl, also akzeptierte er meine Entscheidung. Er fügte noch hinzu, dass er sofort kommen würde, wenn ich einen Wunsch habe.
Naomi, die mir auf Englisch die Emails schickte, bot an, die Interviews zu übersetzen. Ihr kleinster war krank, also kam sie später. Papa und Mama Houshi begrüßten mich und wir gingen zusammen in einen Raum nahe des Garten. Der Lieblingsraum von Zengoro.
Das Interview verlief etwas kompliziert. Naomi redete häufig über die Aufnahme drüber oder unterbrach die Interviewpartner. Es dauerte eine Weile, bis sie meine Arbeitsweise verstanden hatte. Aber sie übersetzte sehr gut. Sie ist quasi auch im Houshi aufgewachsen, geboren ist sie im gleichen Ort. Sie war aber viel im Ausland, spricht vier Sprachen fließend und ihr Mann ist halb Däne, halb Franzose. Zuhause sprechen sie Spanisch.
Zengoro Houshi und sie hatten schon ein gutes Vertrauensverhältnis, von dem ich jetzt profitierte. Er war sehr ehrlich in seinen Aussagen und beantwortete jede Frage eloquent. Nur die Fragen nach der finanziellen Situation des Hotels und ob er je daran gedacht hatte, es zu verkaufen, ignorierte er. „Diese Frage ist nicht würdig einer Antwort.“
Vor der Tür warteten seine Frau und seine Tochter schon. Vater Houshi redete länger als erwartet, also waren die beiden ungeduldig.
Das Interview mit der Mutter verlief nicht sehr gut. Ich merkte schnell, dass sie sich schon sehr früh mit ihrem Leben und ihrer Situation abgefunden hat. Den Wunsch nach mehr hat sie lange schon aufgegeben. Sie hat immer nur das gemacht, was ihr gesagt wurde, und so reflektierte sie auch kaum ihr Leben oder eigene Entscheidungen. Antwort war immer „So wurde es erwartet“ oder „So ist das halt.“ Nichts was ich wirklich als Tonschnipsel nutzen konnte. Zudem schaute sie ständig in die Kamera, obwohl ich sie stets darauf hinwies es nicht zu tun.
Vater Houshi redete anderthalb Stunden, die Mutter nur 17 Minuten.
Dann kam die Tochter.
Sie ist das Herz des Films. Naomi und die Tochter hatten sich vorher nie getroffen, obwohl sie die Familie Houshi eng kannte.
Für die Tochter Hisae war das Interview eine willkommene Möglichkeit, sich einiges von der Seele zu sprechen. Sie hat kein Ventil, keinen mit dem sie offen und ehrlich reden kann. Das merkte ich im Interview. Sie weinte auch mehr als einmal, aber ich entschied mich dazu, das nicht im finalen Film zu zeigen.
Die Tochter wird nie wieder so ein Interview geben, so viel ist sicher. Sie vermeidet auch die Kamera, wo es nur geht. Doch der Patriarch sagte ihr „wir machen das jetzt.“
Der erstgeborene Sohn ist verstorben und sie soll übernehmen. Der zentrale Konflikt in der Geschichte und in der Familie. Ich habe davon erst an diesem Tag erfahren, ich wusste es nicht, als ich zum Houshi aufgebrochen bin. Also frage ich im Interview die Tochter, was sie dazu denkt, dass sie das Hotel übernehmen soll.
Sie wusste von dieser Entscheidung nicht.
Der Vater sagte es ihr vorher nie, sie erfuhr es von mir im Interview, dass sie die nächste in der 1,300 Jahre alten Familien-Linie sein soll. Dass sie die erste weibliche Besitzerin in 46 Generation sein soll. Dass sie die Zukunft ist.
Sie war sehr verwirrt und wusste nicht, was sie sagen sollte. Aber ihre Antworten waren ehrlich und unverfälscht. Eine einzigartiger Moment in der Geschichte der Familie. Und ich war dabei.
Nach dem Interview ließ der Patriarch ein paar Schüsseln Nudelsuppe kommen. Ich saß bei Naomi und Tochter Hisae, Mutter und Vater Houshi saßen an einem eigenen Tisch.
Ich musste an einen Sketch von Harald Schmidt denken, der mal von einer Beobachtung im Zug erzählte. Ein Paar, seit mehreren Jahrzehnten verheiratet, sitzt im Zug und isst mitgebrachte Brote. Sie pellt ihm ein Ei. Harald Schmidt sagte: „Sie pellte ihm ein Ei, wie man nur jemanden nach 30 Jahren Ehe ein Ei pellen kann.“ Wortlos und mechanisch.
So saßen Mutter und Vater Houshi nun auch am Tisch und schlürften ihre Suppe. Mehr als 50 Jahre verheiratet, schauten beide wortlos aus dem Fenster, auf die alte Theaterbühne, die heute nur noch einmal im Jahr bespielt wird.
Wir gingen raus und machten das Familienfoto. Die Idee, das ganze als Video aufzunehmen, kam mir erst am Abend zuvor.
Tochter Hisae war froh, nun nicht mehr vor die Kamera zu müssen und Mutter Houshi zeigte mir das älteste Gebäude im Hotel. Ihr ganzer Stolz.
Die Nacht für ungefähr 600 Euro aufwärts.
Im gesamten Hotel finden sich häufig Darstellungen von Vögeln. Direkt nebenan gab es ja wie gesagt eine Baumkrone voll davon. Ich wollte daraus eine Metapher basteln, die Vögel für die Freiheit bzw. Unfreiheit der Tochter. Hat sich aber doch nicht ergeben. Aber dafür habe ich viele Vögel-Bilder.
Naomi erhielt nach dem Interview aufgeregte Anrufe ihrer Mutter. Ihr Kind war noch krank bei der Oma und sollte schon längst abgeholt sein. Weil sie meine Arbeit und die Interviews aber so spannend fand, hing sie noch etwas Zeit ran. Eigentlich wollte sie nur zwei Stunden für mich übersetzen, aber da wir uns gut verstanden, machte sie eine Ausnahme. Ich bezahlte ihr nichts für die Arbeit, war also froh über die Unterstützung.
Tochter Hisae erzählte mir von der ältesten Mitarbeiterin. Die würde ich gern mal treffen, sagte ich ihr, und sie zeigte mir einen alten Nebenraum.
Die alte Dame ist über 80 und arbeitet seit fast 60 Jahren im Houshi. Jetzt näht sie die alten Futons und Kissen wieder zusammen, sechs Stunden jeden Tag. Sie erzählt, dass dieses Zimmer früher für die Geishas war. Es hat einen eigenen Eingang und führt durch den Flur direkt zu den Zimmern der Gäste (einige Geishas boten früher auch andere Dienste an).
Das Zimmer wirkte älter als der Rest vom Hotel. Mein Professor und auch Miki gaben mir zuvor in Hiroshima den Hinweis: Alte Reismatten, auf denen man die Spuren vom Leben erkennen kann, gelten als erfahren und schön.
Ich hielt im ganzen Hotel danach Ausschau, fand es aber nur hier.
Die Kälte zog durch die alte, offene Schiebetür nun auch in dieses Zimmer. In Pantoffeln und Socken zitterten meine Zehen. Die alte Dame nähte indes barfuß auf dem kalten Holzboden.


Früher Geishas im Zimmer, heute Anime-Kissen
Nach der Tour durch das alte Herz des Hotels, traf ich Naomi noch in der Lobby. Ich musste die Interviews, die teilweise sehr intensiv und persönlich waren, erst einmal verdauen, also ließ ich die Kamera ruhen und plauderte etwas mit ihr. Sie bot mir an, mir den Rest vom Ort zu zeigen, wenn wir zusammen ihr Kind abholen können.
Sie zeigte mir den Friedhof der Houshi. Die Gräber bieten einen Blick auf die Kirschblüte in voller Pracht. In Hiroshima waren die Blüten zu der Zeit schon verschwunden.
Sie lud mich dann zu sich nachhause ein. Ihr Mann ist Bäcker, sie betreiben eine kleine aber sehr gute Bäckerei, fünf Minuten vom Hotel Houshi entfernt. Sie boten mir Wein, Käse und Brot an, während die zwei kleinsten Kinder nebenan versuchten einzuschlafen.
Zurück im Houshi sammelte ich weiter ein paar Bilder. Eine wirkliche Pause hatte ich nie. Das Problem daran, wenn man am gleichen Ort schläft und dreht ist nämlich, dass man immer nach Bildern sucht. Ich wollte kurz das Brot von Naomi und ihrem Mann genießen und sah an der Wand das Lichtspiel vom Fluss. Also Pause beenden, Kamera aufbauen und Linse einstellen.
Die Tochter Hisae suchte seit dem Interview immer meine Nähe. Sie hatte sich mir anvertraut und hatte nun natürlich die Hoffnung, sich weiterhin auf mich verlassen zu können. Sobald sie aber meine Kamera sah, sprang sie aus dem Bild. Am Abend konnte ich sie beruhigen. Da ich seit 5 Uhr früh bereits auf den Beinen war, waren alle meine Akkus aufgebraucht und leer. Die Kamera musste pausieren. „Hoffentlich bleiben die Akkus ewig leer“ sagte sie.
Jeden Abend bereiten ein oder zwei Angestellte den Futon im Zimmer für die Nacht vor.
Hisae arbeitete am Abend im Souvenirladen des Hotels. Sie sprang auch nur für jemanden ein, der gerade im Krankenhaus lag. Abends kauft auch eigentlich keiner Souvenirs, doch sie stand hier trotzdem. Für jede Ablenkung war sie dankbar und daher bot sie mir an – nachdem sie sah, dass ich keine Kamera mit mir hatte – eine Tour zu geben.
Als wir an den vielen Türen vorbeizogen erzählte sie von Prominenten oder berühmten Sportlern, die in diesen Zimmern übernachtet hatten. Dabei fing sie immer wieder an zu verhandeln. Hisae ist sehr schüchtern und hat eine geringe Meinung von sich und ihrem Aussehen. Ich meinte, dass der fertige Film wohl so sechs Minuten lang sein wird und sie davon einen Anteil von mindestens drei Minuten hat. Im Laufe des Gesprächs wollten sie mich immer wieder runterhandeln. Teilweise mitten im Satz. Das klang dann so:
„Hier in diesem Zimmer hat ein berühmter Baseballspieler übernachtet und bitte gib mir nur eine Minute im Film statt drei. Da drüben übernachtete mal ein Sänger von SMAP.“
Wir gingen auch kurz raus in den Abend und sie zeigte mir andere Stellen im Ort, wo die heissen Quellen unter der Oberfläche sprudelten oder wo sie für ihren Hund das Futter kauft.
Ich sammelte anschließend noch bis 22 Uhr Material und war platt. Ich fühlte nach dem Interview die Last der Geschichte auch auf meinen Schultern. Wie sollte ich das mit einer Kamera darstellen können? Ich hatte das Gefühl die Geschichte nicht so erzählen zu können, wie es sie verdient. Ich suchte weiter verzweifelt nach Bildern und ging meine Liste durch, bis ich nach 17 Stunden fast konstant Drehen in den Futon plumpste. Am nächsten Morgen wollte Vater Houshi eine buddhistische Zeremonie halten, halb 7 Uhr früh. Dafür musste ich bereit sein.
Bei meinem ersten Besuch hielt er die Zeremonie nur für mich. Deswegen drehte ich sie bei meinem zweiten Besuch noch einmal nach, dann auch mit Gästen. In den finalen Film hat es die Szene trotzdem nicht geschafft, weil die Präsenz vom Vater sonst viel zu massiv gewesen wäre.
Als nächstes: Die Quelle.
Ich schnappte mir Shou und ein Handtuch und wagte mich ins Bad. Alle paar Sekunden musste ich die Linse reinigen, weil sie beschlagen war. (Halb)nackt habe ich auch noch nie gearbeitet.
Shou hat aber alles mit sich machen lassen.

Als ich fertig war, verstaute ich Kamera, Objektive, Aufnahmegerät und das nasse Stativ von meinem Professor im Nebenraum und legte mich selbst noch einmal für ein paar Minuten ins Wasser.
Die Quelle der Houshi sprudelte vor Jahrhunderten noch direkt unter der Oberfläche. Heute speist sie sich aus drei Quellen, die zwischen drei und sieben Meter tief sind. Das ist aber kein Vergleich mit den meisten anderen Onsen in Japan, die teilweise mehrere hundert Meter tief pumpen müssen.
Die eigentliche Quelle zeigte mir der Patriarch am Ende meines Besuches. Sie ist überraschend unspektakulär.


Im Interview fragte ich die Familienmitglieder „Spielst du ein Instrument?“ Das ist ein recht praktischer Trick im Film, denn erstens komme ich so an lizenfreie musikalische Untermalung und zweitens ist es eine schöne Szene, abseits vom Alltag. Mutter und Tochter meinten dann, sie spielen bzw. üben Shamisen. Für mich hatten sie jetzt nochmal die Shamisen-Lehrerin kommen lassen und haben einen Unterrichtsstunde eingeschoben. Das ist auch eine schöne Szene im Film geworden.
Die Lehrerin war sehr freundlich und lobte die beiden ständig. Aber so richtig gut spielten weder Mutter noch Tochter… Vielleichts lags auch an der Kamera.
Am dritten Tag war ich fertig. Die Knie wackelten, der Kopf dröhnte. Drei Tage ohne Pause schleppe ich das Stativ und die Kamera nun schon durch das Hotel. Ich renne dem Patriarchen hinterher und versuche Hisae zu filmen, ohne dass sie wegläuft. Ich muss ständig kreativ sein und neue Bildideen suchen um dieser großen Geschichte auch nur annährend gerecht zu werden. So ist mein Anspruch.
Am Tag der Abreise stelle ich enttäuscht fest, dass ich es nicht geschafft habe. Drei Tage sind für 1,300 Jahre einfach zu wenig. Ich war unzufrieden, enttäuscht und frustriert mit mir selbst. Aber ich musste wieder zurück nach Hiroshima.
Ich bezahlte die Rechnung für die drei Tage – kostenlos ging zwar nicht, aber ich bekam 70% Journalismus-Rabatt – und Mutter & Tochter brachten mich zum Bahnhof. Tochter Hisae wollte mir unbedingt noch ihren Hund zeigen, einen lauten Kläffer mit frisierten Fell und französischen Namen. Sie warteten mit mir bis mein Zug einfuhr. Ich sagte noch, dass ich wahrscheinlich wiederkommen muss und Hisae fragte aufgeregt „Wann??“
Erst zurück nach Kyoto, dort eine Nacht im Internet-Café übernachten und dann weiter am nächsten Morgen nach Hiroshima. Als ich dort eine Nacht später aufwachte und zur Uni torkelte, fühlte ich mich, als wäre ich einen Marathon gelaufen.
Es war der anstrengendste Dreh, den ich je hatte. Sicher nicht nur wegen der großen Aufgaben, sondern auch wegen dem mangelnden Schlafen davor, danach und währrenddessen. So konnte es nicht weitergehen. Das mindeste ist, dass ich nächstes Mal Pausen einplane.
Es sollte noch fast drei Monate dauern, bis ich erneut im Houshi zu Gast war.